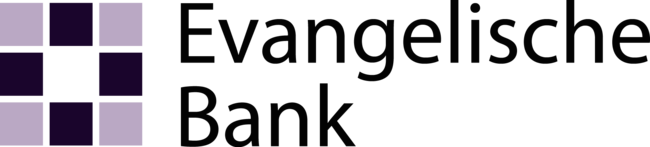Altern in der Werkstatt
Konzepte für den Übergang in den Ruhestand

Die demografische Entwicklung macht auch vor Werkstätten für behinderte Menschen nicht halt. Mit dem Älterwerden verändern sich die Bedürfnisse und Möglichkeiten der Beschäftigten. Am Ende des Arbeitslebens ist der Übergang in den Ruhestand für viele ein einschneidender Schritt. Werkstätten stehen vor der Herausforderung, diesen Übergang nicht nur rechtlich und organisatorisch, sondern vor allem menschlich gut zu gestalten In den letzten Jahren sind dazu vielerorts kreative, durchdachte und personenzentrierte Konzepte entstanden. Die Fachtagung „Der schwierige Übergang von der Werkstatt in den Ruhestand“ von 53° NORD bringt diese Erfahrungen zusammen – und bietet Fachkräften die Möglichkeit, Konzepte für die eigene Praxis zu entwickeln.
Vielfältige Ansätze
Zu den Wegen, die die Werkstätten gehen, gehören u.a. flexible Teilzeitmodelle und spezifische begleitende Maßnahmen. Ziel ist es, den Übergang in die Rente nicht abrupt, sondern fließend, würdevoll und individuell zu gestalten. Viele Werkstätten setzen auf individuelle Anpassungen von Arbeitsplätzen und Tätigkeiten. Trotz nachlassender Leistungsfähigkeit sollen Beschäftigte weiterhin eine sinnstiftende Tätigkeit ausüben können und zugleich mögliche gesundheitliche Belastungen reduziert werden.
In zahlreichen Einrichtungen wurden auch sogenannte Seniorengruppen etabliert – altersgemischte oder altershomogene Gruppen, in denen das Arbeitstempo individuell angepasst werden kann. Diese Gruppen bieten kreative, hauswirtschaftliche oder alltagsnahe Tätigkeiten an und fördern den sozialen Austausch. Sie fungieren oftmals auch als Brücke zwischen regulärem Arbeitsbereich und Ruhestand. Bestandteil vieler Konzepte sind zudem Beratungsgespräche sowie begleitende Schulungs- und Informationsangebote. Dabei stehen Fragen nach Tagesstruktur, Selbstbestimmung und sozialer Einbindung im Vordergrund. Einige Werkstätten arbeiten eng mit externen Partnern – etwa aus dem gemeindenahen Freizeit- und Bildungsbereich – zusammen, um Anschlussmöglichkeiten zu schaffen.
Beispielhafte Praxisprojekte
Die Caritas Werkstätten Rheinberg haben ein umfassendes Konzept namens „Individualisierte Angebote im Arbeitsalltag“ etabliert. Yvonne Evers, Sozialdienstleiterin der Einrichtung, betont: „Bei uns gibt es kein Abschieben. Altern ist eine Herausforderung, der sich die ganze Werkstatt stellt.“ Der Schlüssel: flexible Lösungen, die den individuellen Bedürfnissen älterer Beschäftigter gerecht werden – von ergonomisch angepassten Arbeitsplätzen über Teilzeitlösungen bis hin zu speziellen Ruhezonen. Einmal im Monat treffen sich zukünftige Rentnerinnen und Rentner zudem zu einer „Vorbereitungsgruppe“, in der über Themen wie Rentenansprüche, Freizeitgestaltung und soziale Netzwerke gesprochen wird. Und wer bereits in Rente ist, bleibt Teil der Werkstattgemeinschaft – durch Einladungen zu Festen, Besuchsmöglichkeiten und sogar ehrenamtliches Engagement.
Auch die Ulrichswerkstätten Schwabmünchen zeigen, wie gelebte Inklusion im Alter aussehen kann. Aus einem partizipativen Prozess heraus entstand dort der Aktiv-Club, ein geschützter Arbeits- und Beschäftigungsbereich für älter werdende oder leistungsgeminderte Beschäftigte. Der Clou: Der Club ist solidarisch finanziert, verzahnt mit dem Werkstattalltag, individuell nutzbar – und ermöglicht trotz reduzierter Leistung die Auszahlung von bis zu zwei Dritteln des Werkstattlohns. Neben leichteren Tätigkeiten stehen kreative, soziale und bewegungsorientierte Angebote im Mittelpunkt. Der Aktiv-Club funktioniert dabei als ein sanfter Übergang, der einen abrupter Bruch vermeidet. Ein Jahr vor der geplanten Berentung beginnt in Schwabmünchen die intensive Vorbereitung: Was bedeutet Rente? Wie sieht ein Leben ohne Werkstatt aus? Welche Unterstützungssysteme gibt es im Sozialraum? Ziel ist es, den Übergang in den Ruhestand aktiv zu begleiten – und nicht einfach geschehen zu lassen.
Weitere Konzepte setzen auf Zusatzangebote wie biografisches Arbeiten, Gedächtnistraining, Bewegungstraining oder gemeinsamen Spaziergängen, stets mit dem Ziel, eine sinnvolle Tagesgestaltung und soziale Teilhabe auch jenseits der Erwerbsphase zu ermöglichen. Oder sie bereiten die Integration ehemaliger Beschäftigter in kirchliche und gemeindenahe Netzwerke vor. Ehrenamtliche übernehmen eine begleitende Rolle beim Übergang, beispielsweise durch persönliche Betreuung oder Einbindung in Freizeitangebote.
Fazit: Es geht um mehr als einen Abschied
All diese Initiativen zeigen: Der Ruhestand beginnt nicht mit dem letzten Arbeitstag – sondern mit einer bewussten Vorbereitung und der Chance auf eine neue Form der Teilhabe. Auch wenn der Übergang in den Ruhestand ein bedeutender Meilenstein im Leben jedes Menschen ist, darf er für Menschen mit Behinderung kein Bruch, kein Ausschluss sein, sondern ein neuer Abschnitt mit der Chance auf Teilhabe, Gemeinschaft und Selbstbestimmung.
Wie lassen sich diese guten Beispiele auf meine Einrichtung übertragen? Welche Konzepte können sich in der Praxis unserer Werkstatt bewähren? Und wie gelingt es uns, alle Beteiligten – von Sozialdienst über Gruppenleiter bis hin zu Angehörigen – in den Prozess einzubeziehen? Mit diesen Fragen beschäftigen sich die Teilnehmenden auf der Fachtagung von 53° NORD am 23./24. Juni 2025 in Kassel. Unter dem Titel „Der schwierige Übergang von der Werkstatt in den Ruhestand“ erhalten sie Einblicke in bewährte Konzepte und praxiserprobte Modelle und haben die Gelegenheit, auf dieser Grundlage gemeinsam Lösungsansätze für die eigene Einrichtung zu erarbeiten. Die gemeinsame Überzeugung: Altern in der Werkstatt kann gelingen, wenn Teilhabe, Respekt und Individualität im Zentrum stehen.
Zurück zur Artikelübersicht