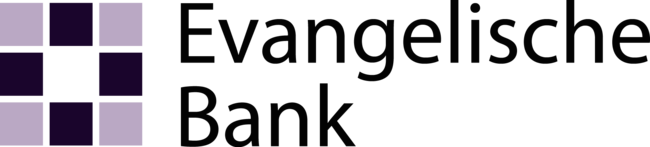Gewalt fängt oft ganz subtil an
Ein Gespräch mit Rebecca Dölling-Künnen von den Ledder Werkstätten

Um Selbstbestimmung und Schutz vor sexualisierter Gewalt dreht sich die inklusive Wander-Ausstellung "Echt mein Recht!" des Kieler PETZE-Instituts für Gewaltprävention. Warum Prävention schon bei der Haltung anfängt, darüber sprach KLARER KURS mit Dr. Rebecca Dölling-Künnen von den Ledder Werkstätten in Tecklenburg-Ledde. Die Referentin für Organisationsentwicklung schildert ihre Erfahrungen mit der interaktiven Ausstellung, die in Ledde von 28 Menschen mit und ohne Behinderung begleitet wurde.
Werkstätten müssen Gewaltschutzkonzepte vorhalten
KLARER KURS: Gewalt in Einrichtungen ist ein oft vernachlässigtes Thema. Die Ledder Werkstätten haben seit 2023 ein Gewaltschutzkonzept, das ganz im Sinne der Petze-Ausstellung auf Empowerment setzt. Was beinhaltet ihr Schutzschirm gegen Gewalt?
Rebecca Dölling-Künnen: Einrichtungen der Eingliederungshilfe und Werkstätten wie unsere müssen ja rechtlich ein Gewaltschutzkonzept vorhalten. Wir haben im Jahr 2021 eine Projektgruppe aufgesetzt, bestehend aus Werkstatt-Fachkräften aus unterschiedlichen Bereichen, aus Vertretern der Beschäftigten – bei uns heißt das Werkstattrat –, also der Menschen mit Behinderung, die bei uns arbeiten, und den Frauenbeauftragten, in deren Rolle die Themen Gewalt und Gewaltschutz natürlich auch mit reinspielen. Und weil wir den Entwicklungsprozess zusammen mit Menschen mit Behinderung gemacht haben, hat das natürlich auch relativ viel Zeit in Anspruch genommen.
Wie lief dieser Entwicklungsprozess?
Wir haben uns in den Projektgruppen intensiv damit auseinandergesetzt, was wir unter Gewalt verstehen. Wir haben Risiko-Analysen erstellt, also geguckt, wo in der Werkstatt die Beteiligten Risiken sehen, dass es zu Gewalt kommen kann. Und auf dieser Grundlage haben wir dann Maßnahmen überlegt.
Welche Maßnahmen sind das?
Wir haben zum Beispiel eine Selbstverpflichtungserklärung für die MitarbeiterInnen erstellt, die zunächst von allen bestehenden Mitarbeitenden hier unterschrieben wurde und mittlerweile in den Einstellungsprozess von neuen Mitarbeiterinnen implementiert ist. Sie richtet sich explizit auf das Thema Gewaltschutz und regelt, wie ich mich als Mitarbeitende der Ledder Werkstätten im Umgang mit Menschen mit Behinderung zu verhalten habe. Das sind Standards, die wir gemeinsam entwickelt haben.

Dr. Rebecca Dölling-Künnen
Gewalt hat viel mit Haltung zu tun
Gewalt fängt schon bei der Sprache an und hat viel mit Hierarchien und Haltung zu tun. Ihre Standards beziehen sich also keineswegs nur auf die erhobene Hand?
Formen körperlicher oder sexualisierter Gewalt sind natürlich das, was bei dem Thema sofort in den Kopf kommt. Aber dass Gewalt gerade auf anderen Ebenen oft ganz subtil anfängt und in Verbindung mit einem Abhängigkeitsverhältnis zwischen Mitarbeitenden und Beschäftigten stehen kann, das ist ein wesentlicher Teil unseres Konzepts. Ein Thema dabei ist die Frage nach Nähe und Distanz. Zum Beispiel, dass ich als Mitarbeitende nicht automatisch Formen des Duzens anwende oder Menschen mit Behinderung nicht einfach so, ohne zu fragen, beim Vornamen nenne.
Vermeintlich wohlwollend-zugewandte Sprache ist übergriffig, "mein Downie" geht also gar nicht?
Absolut nicht. Solche Sprache, solche Sachen, die vermeintlich etwas von Beschützen, Fürsorge, Verniedlichen haben oder gut gemeint sind, sind heikel. Diese übertriebene Haltung der Fürsorge, die davon ausgeht: Ich bin hier der Profi und ich weiß, was gut für dich ist. Mit Formulierungen wie "mein Downie" degradiere und diskreditiere ich den Angesprochenen. In dem Zusammenhang haben wir auch ein Glossar entwickelt, in dem genau dieser Begriff "Downie" auftaucht als eine Bezeichnung, die wir bei uns nicht verwenden – weil das eine unangemessene Verniedlichung von Menschen mit Behinderung ist und sie in einer unangemessenen Weise auf ihre Behinderung reduziert. In unserem Glossar haben wir ebenso Begrifflichkeiten erklärt, die wir benutzen wollen, weil sich ja gerade auch in der Eingliederungshilfe Begriffe vielfach ändern, die auch mit einer Änderung von Haltungen verbunden sind. Zum Beispiel, dass man heute nicht mehr unbedingt vom Betreuer spricht, sondern eher von einer Assistenz. Das bedeutet, dem Menschen selbst mehr zuzugestehen, ihn zu stärken in seiner Person und in dem, was er kann. Das stellt nicht so sehr dieses Behütende in den Vordergrund. Haltung und Sprache sind eng mit dem Thema Gewalt verbunden.
Strukturelle Gewalt
Strukturelle Gewalt ist nicht immer leicht zu erkennen.
Das ist so und macht es auch schwerer, es an Menschen mit Behinderung zu vermitteln, weil sie das häufig als etwas Normales, sage ich jetzt mal, kennengelernt haben. Das sind Dinge, wie die Privatsphäre im Alltag einzuhalten. Missachtung von Privatsphäre kann auch eine Form von struktureller Gewalt sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel einfach, ohne anzuklopfen, ins Zimmer gehe. Oder wenn ich Regeln und Verbote ausspreche, ohne dass der andere die irgendwie nachvollziehen kann. Wenn ich ihm etwa Genussmittel verweigere und ihn damit in seiner Selbstbestimmung einschränke. Oder sowas wie: Ich entscheide, was du heute zum Frühstück isst oder welche Kleidung du heute anziehst, solche Dinge. Das sind Verhaltensweisen, die auch gut gemeint sein können im Sinne von "Ich sorge mich um dich und ich weiß auch, was richtig für dich ist", aber Formen von struktureller Gewalt darstellen können.
Was haben die Maßnahmen bewirkt?
Ich beobachte definitiv eine gewachsene Sensibilität, die auch immer größer wird, gerade auch für die subtileren Ausprägungen von Gewalt. Wir haben nach der Konzeptentwicklung umfangreiche und flächendeckende Schulungen von Mitarbeitenden gemacht und das im Multiplikatoren-System und mit Materialien umgesetzt. Das auch im Bewusstsein zu halten, das ist eigentlich das Herausfordernde. Kontinuierlich, aber auch, ohne es gleichzeitig zu übertreiben. Das ist eine große Gratwanderung. Deswegen bin ich auch so froh, dass wir, nachdem wir noch bis vergangenes Jahr eher mit Schulungen und so weiter noch mehr in dieser Einstiegsphase waren, in diesem Jahr schon die Möglichkeit hatten, die so besondere Ausstellung hier in Ledde zu zeigen. Über die Ausstellung bei uns konnten wir Themen wie Gewaltschutz und Recht auf Selbstbestimmung praxisnah für alle, die Interesse daran haben, auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene und mit anderen Formen thematisieren.

Echt mein Recht!
Wie kam die Ausstellung "Echt mein Recht!" für Menschen mit Beeinträchtigung, die Sie in Ledde drei Wochen lang mit viel Platz in ihrer Therapiehalle gezeigt haben, an?
Wirklich sehr gut. Die Ausstellung stieß auf sehr hohes Interesse und war bestens besucht. Die Herangehensweise der Menschen, die sie sich anschauen, ist sehr unterschiedlich, angefangen davon, wie viel Zeit sie sich dafür nehmen. Das können je nachdem zwanzig Minuten oder auch mehr als zwei Stunden sein, in denen sie sich ganz intensiv mit den Inhalten und den Stationen beschäftigen. Die Ausstellung wurde ja nicht nur gemeinsam mit Menschen mit Behinderung vom Petze-Institut entwickelt, sondern hier bei uns wurden die Besuchergruppen zudem auch von kleinen, eigens dafür geschulten Teams von Menschen mit und ohne Behinderung begleitet, das waren hier 28 Menschen. Eine Station beschäftigt sich zum Beispiel mit dem Thema männlicher und weiblicher Körper und Sexualität, sie stieß auf großes Interesse. Eine andere Station beschäftigt sich mit Liebe und Beziehung, die wurde auch gut besucht. Es ist sehr individuell und vielfältig. Ein Besucher etwa hat sich mit den Sticks eineinhalb Stunden lang alle Hörbeiträge an den Stationen angehört. Ein anderer ist immer wieder zu einer Station gegangen, wo es um Verhaltensweisen etwa in einer Disco geht. Da konnte wirklich jeder was für sich mitnehmen, von mehrfach behinderten Menschen, Menschen mit geistiger Behinderung bis hin zu Menschen mit Behinderung im Übergang zum allgemeinen Arbeitsmarkt.
Was bringt das neue Gewaltschutzkonzept
In Betrieben geht es auch nicht immer korrekt zu.
Unser Gewaltschutzkonzept richtet sich in erster Linie an die Menschen mit Behinderung, die bei uns leben und arbeiten. Wir haben aber auch einen Inklusionsfachdienst, der für die Begleitung von Menschen im Übergang oder auch auf Außenarbeitsplätzen in unterschiedlichen Betrieben zuständig ist. Dadurch, dass sie noch nicht in einem sozialversicherungspflichtigen Angestelltenverhältnis auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt sind, sondern weiterhin Beschäftigte der Werkstatt, werden sie weiterhin vom Fachdienst begleitet, und auch der Werkstattrat mit seinen jeweiligen Zuständigkeitsbereichen und die Frauenbeauftragten bleiben mit ihnen in Kontakt.
Wenn ein Beschäftigter beim Praktikum unangemessen angesprochen wird, kann er sich beispielsweise an den Werkstattrat wenden?
Genau, das ist definitiv ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Gewaltschutz-Ansatzes: Dass Menschen, die betroffen sind – und Menschen mit Behinderung sind immer noch deutlich häufiger von Gewalt betroffen – es ansprechen. Oft haben sie das aber noch nicht gelernt oder müssen erst noch lernen, das nötige Selbstvertrauen dafür wie auch das Vertrauen in die Ansprechpartner zu entwickeln.
Was erwarten Sie zum Schutz von Frauen mit Behinderung vom im Februar beschlossenen Gewalthilfegesetz?
Erstmal ist es grundsätzlich zu begrüßen und ein wichtiger Schritt, über dieses neue Gesetz einen Rechtsanspruch und eine Verbesserung von Schutz und Beratung für Frauen zu erzielen, die von Gewalt betroffen sind. Auch wenn das mit dem kostenlosen Rechtsanspruch noch eine ganze Weile bis zum Jahr 2032 dauern wird. Es ist noch ein langer Zeitraum bis dahin. Und diese Zeit muss genutzt werden, um die Hilfesysteme auch entsprechend auszubauen. Frauen mit Behinderung, und das ist durch Studien belegt, haben ein deutlich höheres Risiko, Opfer von Gewalt zu werden. Für sie, und das ist ja auch im Gesetz vorgesehen, ist eine spezielle Fachberatung nötig. Ich sehe aber eine Problematik darin, dass Hilfesysteme nicht immer auf die Bedarfe von Frauen mit Behinderung ausgerichtet sind, ob es die Barrierefreiheit angeht oder überhaupt das Wissen um das Thema Behinderung oder die Möglichkeiten der Beratung in einfacher Sprache. Gerade bei uns im ländlichen Raum sind die Möglichkeiten der Fachberatung oder etwa Gewalthilfe speziell für Frauen mit Behinderung noch sehr rar gesät. Und Männer mit Behinderung oder Trans-Menschen, die ja auch von Gewalt im Alltag betroffen sind, werden von diesem Gesetz natürlich gar nicht berücksichtigt. Beim Thema Gewaltschutz gibt es also insgesamt noch sehr viel Luft nach oben.
Wanderausstellung "Echt mein Recht!"
Interessenten können die Wanderausstellung "Echt mein Recht!" des Petze-Instituts für Gewaltprävention gGmbH Kiel buchen: Telefon 0431/92333.
Auf der Petze-Homepage ist auch ein 360°-Rundgang durch die Ausstellung zu sehen: www.petze-institut.de
Nach Ledde wird die Ausstellung in diesem Jahr unter anderem noch an folgenden Orten gezeigt: Gelsenkirchen (April), Dötlingen (Mai), Bremervörde (Juni), Kaltenkirchen (Juli), Berlin (Oktober) und Hamburg (November).
Zurück zur Artikelübersicht