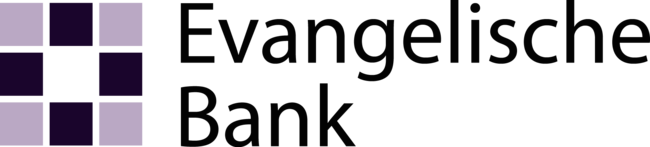"Wie gut, dass es Werkstätten gibt..."
"... und wie notwendig, sie ständig weiter zu entwickeln!"

Dr. Jochen Walter
Werkstätten für Menschen mit Behinderung sind und bleiben ein wichtiger Bestandteil inklusiver Arbeitswelt – doch sie müssen sich weiterentwickeln. Dr. Jochen Walter, langjähriger Vorstand der Pfennigparade, wirft in seinem Gastbeitrag einen Blick zurück auf die Entwicklungen innerhalb der Eingliederungshilfe der vergangenen Jahre. Er macht deutlich: Gute Inklusion braucht nicht nur gute Strukturen, sondern auch Haltung, Ressourcen und Zusammenarbeit. Sein Beitrag ist ein Plädoyer für individuell passende Teilhabe statt pauschaler Lösungen – und ein Aufruf, Werkstätten als gestaltbare Zukunftsräume ernst zu nehmen.
Dass es per se besser ist, außerhalb der Werkstatt zu arbeiten als innerhalb, denn dort seien die Menschen "ausgesondert und diskriminiert", widerlegt die tägliche Praxis. Aus jahrelanger praktischer Erfahrung wissen wir, dass bei weitem nicht jeder Zugang eines Menschen mit Behinderung in den "ersten Arbeitsmarkt" gut ist im Sinne gelungener Inklusion. Vor allem dann nicht, wenn die Person im Unternehmen eher Ablehnung oder sogar Diskriminierung erfährt oder sich im Betrieb als fünftes Rad am Wagen empfindet. Wenn wir von Inklusion reden, muss es also stets um eine fundierte, werthaltige Teilhabe gehen. Nicht nur einfach um Geld gegen Arbeit, sondern auch um sinnstiftende Tagesstruktur mit sozialen Bezügen, auch um berufliche Bildung, auch um gesundheitliche Förderung bei der Arbeit! Das ist mir in den vielen persönlichen Gesprächen mit "Betroffenen" immer klarer geworden. Auch habe ich gelernt: Inklusion auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt gelingt vor allem dann, wenn Expertinnen und Experten inner- und außerhalb der Werkstätten die Beschäftigten und ihre (zukünftigen) Kolleg*innen coachen und begleiten. Diese individuell zugeschnittene Unterstützungsformate kosten jedoch Geld und müssen politisch gewollt sein.
Zugleich gibt es viele Tausend Beispiele gelungener Teilhabe auf Werkstatt-Arbeitsplätzen mit wertschätzender Tagesstruktur, mit Inklusion in den unterschiedlichen "Sozialräumen" und den kooperierenden Wirtschaftsunternehmen, so dass sich dadurch täglich zehntausende Menschen mit und ohne Behinderung begegnen. Jedoch ist bei den sozialraumorientierten und den betriebsintegrierten ("Außen"-)Arbeitsplätzen sowie bei den Übergängen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt noch ordentlich Luft nach oben! Hier voranzukommen, kostet ebenfalls Geld, hat jedoch auch viel mit Strategie, Engagement und Haltung der Verantwortlichen zu tun. Werkstatt auch als personenbezogene Leistung in unterschiedlichen arbeitsweltlichen Kontexten zu begreifen, braucht innere und äußere Reformen. Gerade eine mit Bildungsträgern, Kommunen, regionaler Wirtschaft usw. vernetzte Werkstatt kann vielfältige Arbeitsplätze anbieten und Übergänge gestalten.
Zunächst einmal bräuchte es die allgemein diskutierten und längst überfälligen Schritte, wie:
- eine Reform des Entgeltsystems für Werkstattbeschäftigte, das ihnen insbesondere ein deutlich höheres Einkommen und im besten Fall Unabhängigkeit von der Grundsicherung garantiert,
- eine deutlich aufgewertete Berufsbildung mit allgemein anerkannten (Teil-)Abschlüssen,
- eine Verbesserung der Übergangswege auf den allgemeinen Arbeitsmarkt, u.a. durch ein effektiveres Instrument des Budgets für Arbeit sowie durch Nachschärfung der Anreize für Werkstätten, Werkstattbeschäftigte und Betriebe in Bezug auf den Übergang von Beschäftigten auf den allgemeinen Arbeitsmarkt,
- die Abschaffung des "Mindestmaß an wirtschaftlich verwertbarer Arbeit" als Zugangsvoraussetzung für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben bzw. die Koppelung ihrer Inanspruchnahme an ein persönliches Wunsch- und Wahlrecht.
Nach meiner langjährigen Erfahrung bin ich zudem überzeugt, dass darüber hinaus noch weiteres Potential ausgeschöpft werden könnte: zusätzliche äußere Impulse und Vorgaben – auch im Sinne von gesetzlichen Rahmenbedingungen - können weitere Reformen innerhalb der Werkstätten befördern. Vor kurzem wurde in der Debatte der Gedanke platziert, dass Werkstätten regelhaft Inklusionsfirmen ausgründen – möglicherweise auch als Inklusionsabteilungen mit weiter entwickelten Rahmenbedingungen. Als Träger, der sowohl eine große Werkstatt als auch eine große Inklusionsfirma betreibt, wissen wir in der Pfennigparade, wie wichtig spezifische Rahmenbedingungen und Förder-Settings sind. Einfach mal einige Dutzend Werkstattbeschäftigte in die Inklusionsfirma heutiger Prägung zu verschieben, ändert Geschäftsmodelle, Marktnähe und wirtschaftliche Erfolgsbedingungen der Inklusionsfirma – also ihren Charakter, wie jeder Praktiker und jede Praktikerin vor Ort weiß. Das wird nicht funktionieren.
Aber möglicherweise ist eine gestufte "Teilhabekette", nämlich klassische Werkstatt – zeitlich befristetes Durchlaufen einer "Inklusionsabteilung" inner- oder außerhalb der Werkstatt zur Arbeitsmarktorientierung – allgemeiner Arbeitsmarkt (einschl. Inklusionsfirmen, Budget für Arbeit, Unterstützte Beschäftigung), denkbar. Diese Teilhabekette müsste durch ein teilweise neu zu schaffendes Inklusions- und Übergangsmanagement bespielt werden, das auch Werkstätten entsprechend in die Pflicht nimmt. In den Teilhabestufen Werkstatt und Inklusionsabteilung käme ein existenzsicherndes Entgelt zum Tragen, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt der Arbeitnehmerstatus mit mindestens Mindestlohn. Beispielsweise alle drei Jahre würde für jede/n Werkstattbeschäftigte/n und gemeinsam mit ihr/ ihm ein Status erhoben und Ziele sowie Umsetzungsschritte für ihre/ seine weitere Entwicklung entlang dieser Teilhabekette festgelegt. Damit würde einerseits für Werkstattbeschäftigte, die es wollen und können, der Fokus auf den Weg zum allgemeinen Arbeitsmarkt gesetzt. Andererseits wäre es vollkommen legitim, in der Teilhabestufe Werkstatt zu verbleiben bzw. – wie heute schon üblich – Entwicklungsziele usw. "nur" für diese Stufe zu vereinbaren.
Am Ende des Tages aber bleibt es dabei: Werkstätten halten Ausgleichsstrukturen vor für bisher vom allgemeinen Arbeitsmarkt ausgeschlossene Personen. Diese Menschen hätten nämlich ohne Werkstatt keinen Bezug zum Arbeitsleben und damit auch keinerlei berufliche Perspektive. Ansätze zum Abbau dieser Ausgleichsstrukturen müssen immer mit Ansätzen zum Aufbau inklusiver Arbeitsplätze auf dem Arbeitsmarkt korrespondieren, sonst haben wir insgesamt weniger Teilhabe am Arbeitsleben. Für alle Reformen zum verstärkten Übergang aus Werkstätten in den allgemeinen Arbeitsmarkt bedarf es also mehr Bereitschaft zur Schaffung inklusiver Arbeitsplätze in den Wirtschaftsunternehmen. An dieser simplen "Wahrheit" kommen wir nicht vorbei.
Dr. Jochen Walter war 23 Jahre Vorstand der Stiftung Pfennigparade und 12 Jahre stellvertretender Vorsitzender der BAG WfbM
Zurück zur Artikelübersicht