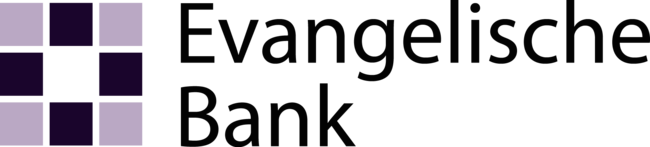Damit aus vielen Schneebällen keine Lawine wird
Interview zur Befragung von Beschäftigten zum Thema Gewalt in der Behindertenhilfe

Dr. Nikolaus Meyer, Professor am Fachbereich Sozialwesen der Hochschule Fulda
Gewalt in der Behindertenhilfe ist weitverbreitet. Das bestätigt eine Untersuchung der Gewerkschaft Verdi und der Hochschule Fulda. Die Studie bringt drei zentrale Ergebnisse hervor: Besonders häufig kommt Gewalt in Werkstätten für Menschen mit Behinderung vor. Oft verhalten sich auch Beschäftigte verletzend oder übergriffig gegenüber Menschen mit Behinderung. Und: Wo Gewalt innerhalb einer Personengruppe geduldet wird, steigt das Risiko für andere Gruppen. Fragen an Professor Dr. Nikolaus Meyer von der Hochschule Fulda.
KLARER KURS: Was war Anlass für die Studie über Gewalt?
Nikolaus Meyer: Die Gewerkschaft Verdi und wir von der Hochschule Fulda haben bereits in mehreren Studien Beschäftigte aus der Sozialen Arbeit befragt. Gewerkschaftlich Aktive meldeten uns zurück, dass unsere Befragungen zu den Arbeitsbedingungen hilfreich seien. Sie sagten aber auch, dass wir Gewalt erforschen sollten. Sie berichteten uns, dass Übergriffe und unangemessenes Verhalten zunähmen. Die Initiative für die Untersuchung kam also von den Beschäftigten.
Anders als in den beiden von den Bundesministerien beauftragten Untersuchungen wandten Sie sich ausschließlich an die Beschäftigten?
Das ist richtig. Wir haben gefragt, ob sie in ihrer Einrichtung psychische, physische und sexualisierte Gewalt erlebt hätten. Interessant ist: Unsere Ergebnisse decken sich größtenteils mit den beiden großen Untersuchungen. Auch dort wurde festgestellt, dass Gewalt gegenüber Menschen mit Behinderungen in Einrichtungen der Behindertenhilfe weitverbreitet ist. Am häufigsten kommt es zu Gewalt zwischen den AdressatInnen. Aber nicht nur. Mit unserer Befragung erweitern wir die Datenlage aus Sicht der Beschäftigten. Mit 226 Fragebögen handelt es sich zwar nicht um ein repräsentatives Ergebnis, aber um eine aussagekräftige Stichprobe mit deutlichen Hinweisen.
Gewalt richtet sich auch gegen Beschäftigte?
Ja. Fast 93 Prozent berichten von psychischer, 76 Prozent von physischer Gewalt, knapp 60 Prozent von sexuellen Grenzverletzungen und fast 42 Prozent von sexuellen Übergriffen – ausgehend von Menschen mit Behinderungen. Allerdings findet Gewalt auch umgekehrt statt. Das Ausmaß von verletzendem Verhalten von Beschäftigten gegen AdressatInnen ist hoch: psychische Gewalt, physische Gewalt, sexuelle Grenzverletzungen. Auch unter den KollegInnen ist Gewalt kein Einzelfall. Wir haben festgestellt, dass in Einrichtungen, in denen psychische Gewalt Alltag ist, das Risiko für andere Gewaltformen hoch ist. Wenn es nicht gelingt, die psychische Gewalt zu verhindern, entsteht aus vielen einzelnen Schneebällen eine Lawine.
Welches Ergebnis hat Sie überrascht?
Wir wissen aus anderen Untersuchungen, dass sich Gewalt aufgrund des Machtungleichgewichts in stationären Einrichtungen konzentriert. In unserer Studie war das nicht so. Das höchste Gewaltniveau berichten Befragte – mehrheitlich ohne berufsfachliche Qualifizierung – aus Werkstätten für behinderte Menschen. Diese sehr hohen Werte in allen Gewaltformen übersteigen deutlich den stationären Bereich (etwa Wohngruppen) oder den ambulanten Bereich (wie betreutes Wohnen.) Das deckt sich mit den Ergebnissen aus den Untersuchungen der beiden Bundesministerien. Aus unserer Befragung wird zudem deutlich, dass auch Beschäftigte in Werkstätten von Gewalt betroffen sind – und auch von ihnen Gewalt ausgeht.
Was sind insgesamt die Gründe für die Gewalt in der Behindertenhilfe?
Dort, wo häufig von psychischer Gewalt durch Menschen mit Behinderung berichtet wird, sind die Arbeitsbedingungen schlecht: hohe Arbeitsverdichtung, Wochenendarbeit, ständige Erreichbarkeit, Lärm, Enge. Die Beschäftigten stehen häufiger unter Zeitdruck, geraten häufiger an ihre Leistungsgrenzen und berichten häufiger, Abstriche an der Qualität ihrer Arbeit machen zu müssen. Ähnlich schlecht sind die Arbeitsbedingungen dort, wo häufig von Gewalt unter den AdressatInnen berichtet wird: viele Nacht- und Spätdienste, Überstunden, wenig Entscheidungsfreiheit, fehlende Unterstützung von Führungskräften. In solchen Einrichtungen sind die häufigen Personalwechsel auffällig. Gewalt ist demnach Ausdruck struktureller Überforderung, schlechter Arbeitsbedingungen und einer Einrichtungskultur, die solche Gewalt billigt.
Was würde helfen?
Es braucht mehr und qualifiziertes Personal. Denkbar wäre eine verbindliche Personalbemessung. Wie ist der Personalschlüssel bei Trägern? Das wissen wir nicht. Wir wissen nicht einmal, wie viele Menschen auf welchen Stellen in der Behindertenhilfe arbeiten. Die Träger müssten die Möglichkeit schaffen, in professionellem Rahmen verletzendes und übergriffiges Verhalten thematisieren zu können – mit allen Betroffenen. Supervision für die Beschäftigten sollte Standard sein. Und Gewaltschutzkonzepte dürfen sich nicht in formalen Handlungsleitfäden und Notfallketten erschöpfen. Im Umgang mit behinderten Menschen zeigt sich doch die Kultur einer Gesellschaft. Wie wollen wir mit den Verletzlichsten umgehen?
Die AVASA-Studie
Das jüngste Forschungsprojekt der Bundesfachgruppe Erziehung, Bildung und Soziale Arbeit der Gewerkschaft Verdi und der Hochschule Fulda behandelt Arbeitsbedingungen und verletzendes Verhalten im Alltag der Sozialen Arbeit (AVASA). An der Befragung haben im Herbst 2024 bundesweit 6.380 Menschen teilgenommen. Letztlich konnten 3.234 vollständig ausgefüllte Online-Fragebögen von Beschäftigten mit mindestens einem Jahr beim gleichen Träger ausgewertet werden. Die Fragebögen sind für jeden Arbeitsbereich der Sozialen Arbeit ausgewertet worden. 226 Befragte sind bei unterschiedlichen Trägern in der Behindertenhilfe beschäftigt. Die meisten von ihnen arbeiten seit vielen Jahren in ihrem Beruf. Drei Viertel der Befragten sind berufsfachlich qualifiziert, sie sind HeilerziehungspflegerInnen, SozialarbeiterInnen, ErzieherInnen sowie Sonder- oder HeilpädagogInnen.
Gefragt wurde nach vier Gewaltformen: psychische Gewalt wie Anschreien, Herabwürdigen, Drohen, Ignorieren, Isolieren; physische Gewalt wie Schubsen, Schlagen, Würgen; sexuelle Grenzverletzungen, etwa unabsichtliches Berühren, sexuelle Übergriffe, wie Witze über den Körper und Aufdrängen unangemessener Gespräche, sowie sexualisierte Gewalt.
Informationen zur Studie gibt es unter: https://avasa.verdi.de