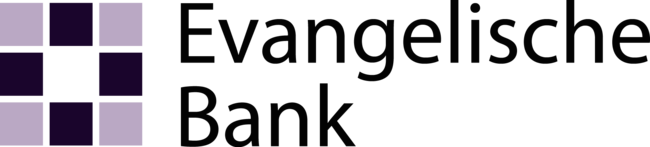Eine sichere Finanzierung für die Zukunft
Impulse für die Sicherung der wirtschaftlichen Stabilität und des Erfolgs der WfbM

Die Rentabilität von WfbM ist von entscheidender Bedeutung, um die wirtschaftliche Stabilität und nachhaltige Entwicklung sicherzustellen. Aber, die wirtschaftliche Lage von Werkstätten hat sich verschlechtert. Laut der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Curacon erzielten im Jahr 2023 nur 58 % der WfbM positive Ergebnisse, während der Anteil von WfbM mit negativen Ergebnissen auf 27 % anstieg. Das liegt nicht nur an der Personalaufwandsquote und den steigenden Löhnen, sondern auch an sich verändernden Märkten, den neuen Anforderungen des BTHGs sowie dem gesamtgesellschaftlichen Wandel zur selbstbestimmten Teilhabe.
Wir sprachen dazu mit dem Unternehmensberater und Fachreferenten der 53° NORD-Seminare „Eine sichere Finanzierung für die Zukunft“ und „Auftragsrentabilität und Auftragskalkulation“ was die aktuellen Herausforderungen sind und welche Impulse es für die Sicherung der wirtschaftlichen Stabilität und des Erfolgs von WfbM braucht.
KLARER KURS: Sie sind in der Unternehmensberatung von Trägern der Eingliederungshilfe tätig. Was genau machen Sie?
Andreas Herbert: Nachdem ich mehrere Jahre zuerst in einer Wohneinrichtung und später auf Seiten eines Kostenträgers tätig war, füllte ich anschließend die Funktionen Qualitätsmanagementbeauftragter, Verwaltungsleiter und stellvertretender Geschäftsführer bei einem Träger in der Eingliederungshilfe mit Werkstätten, besonderen Wohnformen und ambulanten Diensten aus. Seit nunmehr 15 Jahren berate ich bundesweit Träger in der Eingliederungshilfe, und zwar sowohl in den Bereichen Vergütungsverhandlung, Kostenrechnung und Controlling als auch in strategischen und konzeptionellen Fragen, bis hin zur Dienststruktur und Personalbedarfsermittlung mit Personaleinsatzplanung.
Mit der Umstellung auf das Bundesteilhabegesetz sind zusätzliche und besondere Herausforderungen auf die Träger zugekommen, deren wirtschaftliche und konzeptionelle Folgen sich erst langsam zeigen. Die wirtschaftliche Rentabilität in der Eingliederungshilfe bei Weiterentwicklung und Umsetzung der inhaltlich-konzeptionellen Zielsetzungen unter dem Aspekt der Personenzentrierung bilden einen meiner Beratungsschwerpunkte.
Mit Blick auf WfbM: Was sind Ihre Erfahrungen aus der Praxis?
Meine Erfahrungen in den Werkstätten begannen mit dem Aufbau eines Qualitätsmanagementsystems nach DIN ISO 9001 ab dem Jahr 1999 in einer Werkstatt, in der mir gerade auf Leitungsebene deutliche Skepsis gegenüber den Neuerungen entgegenschlug. Die Herausforderung war, ein System zu finden, dass eine Erleichterung für alle Beteiligten darstellte, denn nur so konnte Akzeptanz im Unternehmen hergestellt werden.
Ich musste also zum Fachmann für Details werden, um den mir gegenübersitzenden Handlungspartner*innen fachlich Paroli bieten zu können und geeignete Vorschläge zu finden, die dann auf Zustimmung stießen. Ich lernte sozusagen an der Praxis und an erfahrenen Skeptiker*innen die Anforderungen und die Prozesse der Werkstätten kennen.
Später, als Verwaltungsleiter und stellvertretender Geschäftsführer, baute ich ein Controlling- und Kennzahlensystem eben auch für die Werkstätten auf, das in seinem Detaillierungsgrad versuchte, übersichtlich und gleichzeitig aussagekräftig zu sein. Im engen konstruktiven Austausch mit den inzwischen nicht mehr ganz so skeptischen Kolleg*innen konnten wir dieses System praxisorientiert weiterentwickeln, und zwar sowohl hinsichtlich Kostenstellen und Kostenrechnung als auch im Zusammenhang mit einem Leistungscontrolling für die erbrachten Leistungen für die Klient*innen. Solch ein Leistungscontrolling, das leicht messbar macht, ob zum Beispiel die Ziele der Förder- (heute: Teilhabe-)planung erreicht sind, wird in Zukunft immer wichtiger werden und voraussichtlich mittelfristig auch bundesweit verpflichtend, da dies im BTHG unter dem Begriff „Wirkung“ angelegt ist.
Was hat das BTHG verändert?
Das BTHG rückt einerseits den Fokus sehr deutlich auf die oder den einzelnen Leistungsempfänger*in und erwartet unter den Stichworten Assistenz und Wirkungscontrolling eine doch recht veränderte Leistungserbringung auf Augenhöhe und mit einem Ergebnis im Sinne einer Wirkung der Assistenzleistung. Ich bin da pragmatisch: jede*r sollte regelmäßig über die professionelle Zielerreichung mit den Klient*innen reflektieren. So beinhaltet z.B. der PIT, das personenzentrierte Bedarfsermittlungs- und Teilhabeplanungsinstrument in Hessen, Ziele, die trägerbezogen ausgewertet werden können. Das heißt, ich benötige als Träger definierte Kennzahlen und SMARTe Ziele. Es geht also zentral um die Fähigkeit einer smarten Zielformulierung und nicht darum, eine Kontrolle der Zielerreichung zu vermeiden. Daraus lassen sich wichtige Erkenntnisse ziehen.
Was bedeutet das für die alltägliche Arbeit?
Auch wenn das auf ersten Blick nicht neu erscheinen mag, zeigen sich in der Praxis – gerade anhand der inzwischen fast flächendeckend eingeführten Bedarfsermittlungsinstrumente – deutlich veränderte Anforderungen an die alltägliche Arbeit auf allen Ebenen.
Darüber hinaus führt die teilweise komplette Umstellung der Leistungsfinanzierung in vielen Bundesländern zu deutlichen Verwerfungen in der Rentabilität, oder zumindest zu sehr hoher Ungewissheit bezüglich Steuerungssystematik und Erfolgskriterien. Alte Instrumente greifen häufig nicht mehr, neue sind noch nicht wirksam entwickelt.
Beispielhaft seien hier zu nennen: zunehmende Tätigkeiten der Beschäftigten außerhalb der Werkstattgebäude oder veränderte Anforderungen durch Menschen in den Werkstätten mit höheren Assistenzbedarfen, die durch die Umstellung auf das Bundesteilhabegesetz nun durchaus im Arbeitsbereich Leistungen erhalten können. Als WfbM muss ich mir sehr genau überlegen, ob ich diesen „1:3 Personenkreis“ wirklich fördern will. Wenn ja, dann brauche ich dafür ein gutes Konzept, das rentabel ist. Gerade dies stellt auch die Rentabilität und deren Bewertung für die Produktion vor neue Herausforderungen, auf die wir Antworten finden müssen.
Die wirtschaftliche Lage von WfbM hat sich also verschlechtert. Was ist passiert?
Zum einen versuchen die Kostenträger zunehmend, Gelder für die Werkstätten einzusparen, da sie nicht mehr als vollständig inklusive Situation im heutigen Kontext des Bundesteilhabegesetzes betrachtet werden (zum Beispiel wurden in fast allen Bundesländern Finanzierungen für Werkstätten aus Mittel der Ausgleichsabgabe gestrichen). Zum anderen ist – bisher vor allem in den städtischen Gebieten – eine Tendenz bei den EntscheiderInnen über die berufliche Zukunft der Betroffenen zu erkennen, dass Werkstätten nicht mehr zwangsläufig die erste Wahl sind. Dazu gibt es weniger werkstattfähige Menschen, und viele kommen einfach nicht mehr in der WfbM an. Oder sie kommen dann zeitverzögert an, was auch eine Herausforderung darstellt, und konzeptionelle Anpassungen erfordert (Stichwort „Nachsozialisation“).
Darüber hinaus haben sich die Rahmenbedingungen für einen rentablen Produktionsbereich in vielen Regionen aufgrund der wirtschaftlichen Situation und von Fachkräftemangel verschlechtert, so dass das Produktionsergebnis nicht mehr Unterfinanzierungen aus Eingliederungshilfeerlösen auffangen kann.
Die Werkstätten geraten also (ähnlich wie die besonderen Wohnformen) gleichzeitig unter finanziellen und konzeptionellen Weiterentwicklungsdruck.
Auch Leitungsverantwortliche sehen für die Zukunft als größte Herausforderung die wirtschaftliche Entwicklung & die Sorge vor einer zu geringen Finanzierung. Was können WfbM tun?
Werkstätten müssen versuchen, zum einen attraktiv zu sein für die (potentiellen) Beschäftigten durch partnerschaftliche Assistenz in der Leistungserbringung und interessante Arbeitsangebote in der Produktion sowie die Möglichkeit der stufenweisen Weiterentwicklung für den oder die Einzelne*n in Richtung allgemeinen Arbeitsmarkt. Unter diesen Bedingungen sollten auch Kostenträger bereit sein, eine kostendeckende Finanzierung im Sinne und Interesse der Menschen mit Behinderung zu gewährleisten, möglicherweise sogar auf projektbezogene Finanzierungsbedarfe einzugehen. Eine Öffnungsklausel ist im BTHG ja dafür vorhanden, neue Wege auszuprobieren, wenn es sich um ein tragfähiges Konzept handelt. Meines Erachtens wird das viel zu wenig gemacht.
Aber ich kann ja als Träger mit einer Idee an den Start gehen und dann losgehen. Also lieber tatkräftig vorangehen, als diskutieren und nach hinten schauen. Man könnte sagen: gut, wir entwickeln Konzepte, die die Menschen zum Beispiel in ihrer Selbständigkeit stärken, ihnen mehr Verantwortung und auch Eigenverantwortung übergeben oder sie selbst als Experten stärkt und einsetzt und so die Fachkräfte wiederum entlastet.
Wie geht man mit den Herausforderungen im Produktionsbereich um?
Die Produktion muss teilweise neu gedacht werden: In vielen Regionen entsteht neben dem längst vorhandenen Fachkräftemangel zunehmend auch ein Arbeitskräftemangel, so dass Auftraggeber und Auftraggeberinnen Interesse haben, auch geringer qualifizierte Tätigkeiten gebündelt extern zu vergeben. In diese Chancen sollten Werkstätten versuchen neue Betätigungsfelder und Arbeitsweisen zu erschließen. Zum Beispiel mit Teilzeit- oder Abrufarbeit in Firmen oder mit spannenden Tätigkeiten, die es unter dem Dach der Werkstatt so nicht gibt.
Wie können die beiden Seminare helfen?
Die beiden Seminare haben vornehmlich Rentabilität sowie das Erkennen von Deckungslücken zum Inhalt. Bei den Deckungslücken geht es vor allem darum zu erkennen, in welchen Bereichen welche Lücken vorhanden sind und wodurch sie entstanden sind. Aus diesen Erkenntnissen definieren sich dann in der Folge die Verbesserung der Analyse- und Steuerungsmethoden. Aber bevor man mit Controlling anfängt, sollte man wissen, wo man hinwill.
Insgesamt lässt sich sagen, dass wir die klassischen Managementfähigkeiten in den Organisationen schulen und schärfen. Denn diese sind aktuell gefragt. Nach Jahren einer soliden Finanzierung wird die Luft dünner – aber es gibt Antworten und Lösungswege.
Vielen Dank für das Gespräch!
Zum Seminar„Eine sichere Finanzierung für die Zukunft“
Zum Seminar„Auftragsrentabilität und Auftragskalkulation“