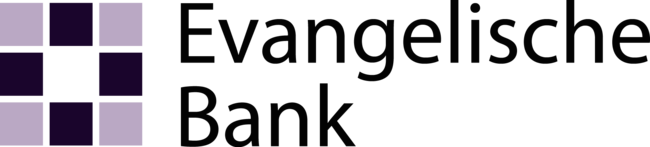„Qualifizierung in der Werkstatt kann und muss vielfältiger gedacht werden“
Die sonderpädagogische Zusatzqualifizierung gezielt als Personal- und Organisationsentwicklungsinstrument nutzen

Die Qualifizierung zur geprüften Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung (gFAB) und die SPZ auch für die Leitung ist ein zentraler Baustein für die professionelle Arbeit in Werkstätten. Sie vermittelt pädagogische, arbeitsweltbezogene und rechtliche Kompetenzen, die für eine zeitgemäße und personenzentrierte Teilhabe am Arbeitsleben unerlässlich sind. Ortrun Müther ist Dozentin für diverse SPZ und hat in über 20 Jahren beruflicher Tätigkeit in unterschiedlichen Einrichtungen der beruflichen Bildung und Rehabilitation vielfältige Erfahrungen in der Entwicklung, Planung, Durchführung beruflicher Bildung-, Integrations- und Personalentwicklungsmaßnahmen gesammelt. Sie beleuchtet die aktuellen Chancen und Herausforderungen in der Ausbildung und erläutert, warum diese Zusatzqualifizierung heute mehr denn je gebraucht wird.
Frau Müther, ein zentraler Bestandteil dieser sonderpädagogischen Qualifikation ist die Projektarbeit, die die TeilnehmerInnen schriftlich erstellen, präsentieren und verteidigen. Warum ist diese so wichtig?
Gegenstand der schriftlichen Projektarbeit ist ein konkretes Projekt, das im Vorfeld der Verschriftlichung von den Teilnehmern der Fortbildung entwickelt, geplant, durchführt, reflektiert und ausgewertet werden muss. Je nach Thema der Projektarbeit fließen verschiedenste fachliche Inhalte der Fortbildung in ein Projekt ein und werden in den Handlungen der Fachkraft sichtbar. Mit der schriftlichen Projektarbeit soll die im Rahmen der Fortbildung erworbene bzw. erweiterte, berufliche Handlungskompetenz nachgewiesen werden. Berufliche Handlungskompetenz beschreibt die Kompetenz zielgerichtet und situationsgerecht zu handeln. Das ist etwas, was sich in Prüfungen nur sehr schwer ermittelt werden kann. Im Rahmen eines Praxisprojektes wird diese Kompetenz aber sehr gut sichtbar.
Nach meiner Kenntnis muss das Projektthema eingereicht und genehmigt werden. Können Sie uns ein paar Beispiele für Projektthemen geben, die bewilligt werden?
In der Orientierungshilfe der Fachkraft für Arbeits- und Berufsförderung heißt es: „Bei der Projektarbeit handelt es sich um eine komplexe, praxisbezogene und berufstypische Aufgabe, nicht um eine theoretische Abhandlung. Das Projekt soll zumindest konzeptionell neu im Sinne von innovativ sein und darf nicht schon einmal durchgeführt worden sein.“ Das kann eine personenzentrierte Förderung oder ein neues einrichtungsbezogenes Angebot, wie z.B. den Aufbau einer teilautonomen Arbeitsgruppe, die Entwicklung eines Schulungsangebots oder eine andere Maßnahme sein. Aber auch in Fortbildungen für Führungskräfte, die ja in der Regel nicht direkt mit den behinderten Menschen zusammenarbeiten und deren berufstypische Aufgabe nicht die Förderung der behinderten Menschen betreffen, sollte das Projekt die WfbM bei der Erfüllung ihres gesetzlichen Auftrages - der Förderung der beruflichen und persönlichen Entwicklung der behinderten Menschen mit dem Ziel der Verbesserung ihrer Chancen zur echten Teilhabe - ein Stückchen weiterbringen.
Wieso ist „innovativ“ hier so wichtig?
Nun ja, das zu tun und zu verschriftlichen, was wir schon immer machen, stellt ja keine Erweiterung der beruflichen Handlungskompetenz dar und dafür benötigen wir dann auch keine Fortbildung, in der neue Inhalte vermittelt werden. Ich höre immer mal wieder von Fachkräften und auch von Führungskräften, dass sie ja schon so viel machen und dass das, was sie machen, gut ist und dass sie keine Notwendigkeit sehen etwas zu verändern, etwas Neues zu entwickeln. Das soll auch nicht infrage gestellt werden. Die Werkstätten haben sich in den letzten Jahrzehnten verändert, sie haben neue Angebote entwickelt und gehen neue Wege. Aber wir sind noch lange nicht an dem Punkt angekommen, an dem wir sagen könnten, dass wir alle Ziele erreicht haben und nicht noch besser werden können.
Projekte sind durch die Einmaligkeit der Bedingungen und klare Zielvorgaben gekennzeichnet. Sie sind eben keine Routineaufgaben, sondern beschäftigen sich mit etwas Neuem. Eine personenzentrierte Förderung ist an sich schon immer etwas Neues, etwas Einmaliges, denn jede Person ist zu jedem Zeitpunkt einmalig. Aber auch darüber hinaus kann nochmal genau geschaut werden, was Beschäftigte heute in der WfbM tun und was sie zukünftig darüber hinaus tun können. Wie werden sie heute in ihrer beruflichen und persönlichen Entwicklung gefördert, auf welche neuen Aufgaben können sie vorbereitet werden bzw. welche weiteren Aufgaben können Beschäftigten in der Werkstatt übernehmen und in welche Prozesse können sie aktiver einbezogen werden. Die Werkstatt in sich ist heute noch kein inklusiver Ort. Es gibt die Aufgaben der Beschäftigten, die Aufgaben der Fachkräfte und die Aufgaben der Führungskräfte. Ich kenne so viele Werkstätten, in denen immer noch keine Mitarbeit von Beschäftigten in der Verwaltung stattfindet.
Welche Herausforderungen gibt es für die Teilnehmenden bei der Erstellung der Projektarbeit noch?
Viele empfinden die Themenfindung schon als Herausforderung. Aber auch das geforderte strukturierte Vorgehen und das Schreiben eines längeren Textes ist für viele eine ungewohnte Aufgabe, die ihnen im Berufsalltag selten verlangt wurde.
Wie schaffen Sie es, dass Ihre TeilnehmerInnen diese Hürden schaffen?
Nun, die Hürde des Schreibens kann überwunden werden, indem wir eine Schreibwerkstatt anbieten. Das sind einzelne Tage, an denen mögliche Gliederungen erarbeitet und Schreibübungen, ein wenig wie beim kreativen Schreiben, zu unterschiedlichen Gliederungspunkten angeleitet und begleitet werden. Erste Idee zum strukturierten Vorgehen erschließen die Teilnehmer sich in der Regel schon bei der Erstellung einer Gliederung. Aber auch die für die Projektarbeit zu nutzenden Methoden sind eine gute Hilfestellung.
Die Themenfindung ist für viele TeilnehmerInnen ein längerer Prozess. Zunächst beschäftigen wir uns mit den Rollen und Aufgaben der Fachkraft bzw. Führungskraft. Daraus ergibt sich dann schon ein Rahmen. Innerhalb dieses Rahmens gibt es aber viele Spielräume. Die werden wiederum eingeengt, weil die TeilnehmerInnen nicht ihre Ziele, sondern die der Beschäftigten berücksichtigen müssen und darüber hinaus engt auch der zeitliche Rahmen, in dem das Projekt durchgeführt und die Projektarbeit geschrieben werden muss, die Möglichkeiten noch mal ein, setzt Grenzen. Und dann sollte die Projektarbeit auch einen nachhaltigen Nutzen haben, für die am Projekt Beteiligten, für die Einrichtung und für die Erfüllung des gesetzlichen Auftrages.
Bei Inhouse-Schulungen können wir im Vorfeld mit der Leitung und den Teilnehmern klären, wo will die Einrichtung hin, was wird dafür gebraucht, was ist schon da und was muss neu entwickelt werden. Aus den Ergebnissen dieser Analyse lassen sich Themen für die Projektarbeit ableiten und nicht nur die TeilnehmerInnen, sondern die ganze Einrichtung profitiert von der kontinuierlichen professionellen Begleitung des Projektes durch die Kursleitung und die fachliche Expertise der Dozenten.
Können Sie Beispiele für nachhaltig erfolgreiche Projekte nennen?
Ja, natürlich könnte ich da viele nennen! Zwei herausragende Projekte sind mir aber noch sehr präsent, weil sie Aufgabenbereiche berührten, die sehr selten gewählt werden und ich konnte mich auch nach einem Jahr bei einem Besuch der Werkstatt nochmal davon überzeugen, dass die Projekte Bestandteil des allgemeinen Angebots geworden sind. Sie wurden im Rahmen einer Inhouse-SPZ für Führungskräfte entwickelt. Die Aufgabenbereiche beider Teilnehmer waren nicht dadurch gekennzeichnet, dass sie direkt mit Beschäftigten zusammenarbeiten und pädagogische Aufgaben zu erfüllen hatten. Ein Projekt beschäftigte sich mit der Einbeziehung Beschäftigter in die Bearbeitung von Anfragen und die Erstellung von Angeboten und das zweite mit der Qualifizierung von Beschäftigten zu QM- Beauftragten.
Erzählen Sie uns von dem ersten Projekt.
Herr G. arbeitete vor Eintritt in die WfbM in der Automobilindustrie und war in der WfbM zuständig für die Akquise von Arbeitsaufträgen. Er war noch nicht lange in der WfbM und es dauerte lange, bis er davon überzeugt werden konnte, dass es in seinem Aufgabenbereich möglich ist, Beschäftigte der WfbM einzubeziehen. Im Verlauf des Projektes hat sich die Sichtweise von Herrn G. komplett verändert. Er selbst sagte, dass er erst durch das Projekt den Menschen richtig begegnen und erleben konnte, wie leistungsfähig sie ein können. „Wir müssen ihnen nur etwas zutrauen und sie personenzentriert an neue Aufgaben heranführen.“ Herr G. qualifizierte drei Mitarbeiter für die Bearbeitung von Anfragen. Gemeinsam gliederten sie den Arbeitsprozess zur Bearbeitung des Auftrages und erstellten auf der Grundlage ihrer Zeitaufnahmen eine Kalkulation für das Angebot. Die Gruppe trifft sich nun regelmäßig, wenn Anfragen eingehen, bestehende Aufträge überprüft werden und um die eigene Arbeit zu reflektieren und zu verbessern.
Welche Auswirkungen hatte das Projekt auf die Teilnehmenden?
Sehr positive! Die Mitarbeiter zeigten bereits im ersten Durchlauf großes Interesse, stellten konstruktive Fragen und übernahmen nach einer einführenden Schulung die neuen Aufgaben mit großem Engagement und machten Verbesserungsvorschläge. Besonders interessant war, dass Herr G. erkannte, dass die Mitarbeiter oft Arbeitsweisen entwickelten, die sich als effizienter herausstellten als die von ihm geplanten. Die Existenz des Anfrageteams hat sich im Hause herumgesprochen und weitere Beschäftigte haben ihr Interesse an einer Mitarbeit bekundet.
Und wie sah das zweite Projekt aus?
Herr B. war schon seit vielen Jahren als Abteilungsleiter und QMB in der Einrichtung tätig. QMB-Aufgaben wurden bis zu seinem Projekt nur von Angestellten der Einrichtung übernommen. Das wollte Herr B. mit seinem Projekt ändern. Er wollte, dass auch Beschäftigte als Qualitätsbeauftragte (QB) tätig werden und dem Thema in den Abteilungen so ein stärkeres Gewicht geben. Zunächst entwickelte Herr B. ein Qualifizierungskonzept, d.h. eine Schulung und sprach gezielt Beschäftigte aus unterschiedlichen Abteilungen an. Er stellte ihnen sein Projekt und ihre zukünftigen Aufgaben vor und nach Einwilligung der Beschäftigten startete die Schulung, die mit einer Prüfung abgeschlossen wurde.
Was waren die genauen Ziele dieser Qualifizierung?
Die neuen QBs sollten in Fragen der Qualitätssicherung und der kontinuierlichen Verbesserung der Produktionsprozesse als Ansprechpartner für Beschäftigte und Fachkräfte in ihren Abteilungen fungieren. Die QM-Themen werden von ihnen regelmäßig in die Morgenbesprechungen eingebracht, Störungen und Verbesserungsvorschläge werden von ihnen aufnehmen und an den QMB weitergeleiten. Darüber hinaus übernehmen sie Dokumentationsaufgaben der Qualitätsprüfung.
Das hört sich aber durchaus anspruchsvoll und schwierig an?
Das ist es auch, aber es ist Herrn B. gelungen, Beschäftigte für die Aufgabe zu gewinnen, die die erforderlichen Kenntnisse in den Kulturtechniken mitbringen und die mit den von Herrn B. entwickelten und sehr einfach strukturierten Formblättern gut arbeiten können. Für die Moderation in den Morgenbesprechungen gab es einen Leitfaden und ein Moderationstraining. Die Schulung umfasste zehn Workshops, in denen die Teilnehmenden schrittweise an ihre neuen Aufgaben herangeführt wurden. Eine Teilnehmerin übernahm darüber hinaus die organisatorische Begleitung der Schulung. Sie erstellte Protokolle, Anwesenheitslisten, führte eine LOP-Liste, buchte die Räume und bereitete sie für die Schulung vor.
Welche langfristigen Effekte hat dieses Projekt?
Bei meinem Besuch konnte ich mit den Teilnehmern und vielen anderen Beschäftigten reden. Aus ihrer Sicht hat das Thema Qualität einen höheren Stellenwert gewonnen und es ist zu ihrer Sache geworden. Aus Sicht von Herrn B. ist das Thema Qualität inzwischen bei 50 % der Beschäftigten wirklich im Kopf angekommen und die Aufgaben der QBs sind richtig populär geworden. Herr B. hat auf das breite Interesse reagiert, sein Qualifizierungskonzept weiterentwickelt und die Schulungen künftig im Co-Teaching durchgeführt.
Welche Erkenntnisse nehmen Sie aus diesen Projekten mit?
Die Beispiele zeigen mir, dass die Werkstätten noch viel Potential haben, in sich inklusiver zu werden und dass Qualifizierung in der Werkstatt vielfältiger gedacht werden kann und muss. Sie zeigen mir aber auch, dass die SPZ und gFAB nicht nur für die fachliche Qualifizierung der Fachkräfte sehr wichtig ist, denn dort bekommen sie das Handwerkszeug vermittelt, das sie brauchen, um ihre Aufgabe zu erfüllen, sondern auch von der Einrichtung gezielt als Personal- und Organisationsentwicklungsinstrument genutzt werden können.
Wenn eine enge Abstimmung der strategischen Ziele der Einrichtung und der Themen der Projektarbeit gelingt, dann ist die Fortbildung für alle, die Fachkräfte, die Einrichtung und die Beschäftigten eine nachhaltige Investition. Wichtig ist, dass die Projekte im Sinne eines Coachings von der Lehrgangsleitung begleitet werden. Das kann in Inhouse-Schulungen in der Regel eher gelingen, weil es nicht so viele Ansprechpartner für die Lehrgangsleitung gibt.
Danke für das Gespräch!
Die 53° NORD Angebote dazu finden Sie hier:
Zurück zur Artikelübersicht