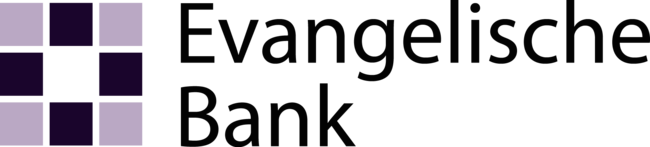Werkstätten können ihr Image beeinflussen, oder?
Ein Kommentar zur Bedeutung authentischer Kommunikation in Zeiten wachsender Werkstattkritik

Seit der Krämer-Petition 2021 stehen Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) verstärkt in der öffentlichen Kritik. Die Berichterstattung ist durchweg kritisch, Social-Media-Kampagnen hinterfragen die Daseinsberechtigung von Werkstätten, und Aktivisten und Aktivistinnen verstärken diese Darstellung. Gleichzeitig melden auch (potentielle) GeschäftskundInnen der WfbM zunehmend negatives Feedback zurück aufgrund von Kritik, die sie (online) lesen. Authentische Gegenkampagnen wiederum blieben aus oder waren medial weitgehend wirkungslos, insbesondere, weil sie inhaltlich eher über Menschen mit Beeinträchtigung sprachen, statt mit ihnen oder durch sie.
Das Imageproblem verstehen
Viele Werkstätten reagieren mit Unverständnis oder setzen auf Imagekampagnen, die oft an der Realität der Beschäftigten vorbeigehen. Beide Strategien greifen zu kurz. Um das Image nachhaltig zu verbessern, müssen Werkstätten verstehen, wie die öffentliche Meinung entsteht.
"Es wird viel zu viel über Menschen mit Beeinträchtigung gesprochen, selten mit ihnen und noch weniger durch sie" – dieser Satz fasst ein Kernproblem vieler Werkstätten zusammen. Die klassische Herangehensweise, bei der Fachkräfte bestimmen, was gut für Beschäftigte ist, ohne echten Dialog, verstärkt das Imageproblem und widerspricht dem Grundgedanken der UN-Behindertenrechtskonvention.
Wie Medien ticken
Journalistische Grundsätze stehen heute unter enormem wirtschaftlichem Druck. Die Digitalisierung hat diesen Druck verstärkt: Nachrichtenfaktoren wie Konflikt, Empörung und Emotionen bestimmen maßgeblich, worüber berichtet wird. In der Berichterstattung über Werkstätten suchen Journalist*innen oft nach dem Konflikt, der emotionalen Geschichte, dem Problem – und weniger nach der differenzierten Betrachtung. Freie Journalist*innen haben zudem selten die Möglichkeit, sich tiefgehend mit der komplexen Thematik auseinanderzusetzen.
Die gute Nachricht: Soziale Medien bieten Werkstätten die Chance, selbst zu Wort zu kommen und ihre eigene Geschichte zu erzählen. Statt nur auf Kritik zu reagieren, können WfbM proaktiv handeln. Dafür braucht es mehr als sporadische Posts – es braucht eine durchdachte Strategie, authentische Inhalte und vor allem: Befähigung von Menschen mit Beeinträchtigung zur digitalen Teilhabe.
Die Ressource Mensch als wertvollster Schatz
Der Schlüssel zu einem authentischen Image liegt in den Menschen, die in den Werkstätten arbeiten. Sie sind Expert*innen in eigener Sache, deren Perspektiven, Erfahrungen und Geschichten den wertvollsten Schatz bilden – einen Schatz, der viel zu selten gehoben wird.
Eine erfolgreiche Strategie setzt genau hier an: Die Beschäftigten selbst zu Wort kommen lassen und sie aktiv an der Kommunikation beteiligen. Dabei geht es insbesondere auch um ein echtes Zulassen von Kritik und eine ehrliche Auseinandersetzung mit dieser. Das bedeutet einen Paradigmenwechsel – weg von PR-Projekten, die vermeintliche Inklusivität vorgaukeln, hin zu echten partizipativen Ansätzen, bei denen Beschäftigte wirklich mitentscheiden. Dies wiederum erfordert die Bereitschaft, Verantwortung und Gestaltungsspielraum zu teilen - sowie Mut, die richtigen Fragen zu stellen, etwa: Arbeiten wir wirklich auf Augenhöhe? Was traue ich meinem Gegenüber wirklich zu? Und genau dieser Mut wird belohnt: mit Authentizität, Glaubwürdigkeit und einer Kommunikation, die tatsächlich bei Menschen ankommt.
Von der Theorie zur Praxis: Inklusive Kommunikation
In unserer Praxis erleben wir immer wieder, wie wirksam dieser Ansatz ist. Ein Beispiel sind inklusive Social-Media-Teams, in denen Beschäftigte gemeinsam mit Kommunikationsexperten und Expertinnen Inhalte planen, erstellen und veröffentlichen. Auch Blogs und Podcasts haben sich als wirksame Formate erwiesen. Im inklusiven Blog-Projekt “Xblog” etwa schreiben Menschen mit psychischen Erkrankungen über ihre Erfahrungen im Arbeits- und Lebensalltag. Ähnlich funktionieren inklusive Podcasts, in denen Beschäftigte über Themen sprechen, die ihnen wichtig sind, etwa im “Xtalk” oder “#berlinklusiv”.
Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass der Erfolg solcher Projekte nicht auf kurzfristigen PR-Maßnahmen basiert, sondern auf langfristiger, intrinsischer Motivation. Menschen entscheiden sich für eine Werkstatt, weil sie sich wertgeschätzt und selbstwirksam fühlen. Diese Erfahrung nach außen zu kommunizieren, schafft Glaubwürdigkeit und verändert das Bild der Werkstätten nachhaltig.
Werte als Fundament
Eine erfolgreiche Image-Strategie beginnt nicht mit der Frage "Wie wollen wir gesehen werden?", sondern mit der tieferen Reflexion: "Wofür stehen wir eigentlich?" und “Gibt es bei uns wirklich gelebte Inklusion oder steht diese nur auf dem Papier?" Soziale Organisationen wissen meist, was sie antreibt – doch oft fällt es schwer, diese Werte klar zu kommunizieren, geschweige denn sie im Arbeitsalltag wirklich in die Tat umzusetzen.
Bei der Begleitung von Werkstätten erleben wir oft ähnliche Herausforderungen: Werte sind intern oft klar, aber extern nicht sichtbar. Die Kommunikation wirkt beliebig oder zu allgemein. Oder bestehende Werte passen nicht mehr zur aktuellen Praxis. Eine authentische Kommunikationsstrategie, die auf den eigenen Werten basiert, schafft dagegen Klarheit – nach innen wie nach außen. Sie vermittelt glaubwürdig, wofür die Werkstatt steht, und schafft eine tragfähige Basis für alle weiteren Kommunikationsmaßnahmen.
Praktische Umsetzung: Der Weg zu einem besseren Image
Wie gelingt der Weg zu einer authentischen, inklusiven Kommunikation konkret? Drei zentrale Säulen haben sich bewährt:
1. Eine professionelle Basis schaffen
Auch wenn die Beschäftigten im Mittelpunkt stehen – ohne professionelle Unterstützung geht es nicht. Werkstätten brauchen klare Prozesse: Wer macht was? Wann? Wie? Fachkenntnisse müssen systematisch aufgebaut werden, sowohl für MitarbeiterInnen als auch für beteiligte Beschäftigte. Ein klarer Redaktionsplan, definierte Zuständigkeiten und regelmäßige Schulungen sind unerlässlich. Diese Investition lohnt sich, denn sie bildet das Fundament für eine nachhaltige, wirksame Kommunikation.
2. Inklusive Zusammenarbeit leben
Werkstatträte und Frauenbeauftragte sind keine "Alibi-Beteiligung", sondern echte ExpertInnen. Sie kennen die Bedürfnisse und Perspektiven aus erster Hand. Ihre Expertise und Kritik muss gezielt eingebunden und gestärkt werden. Unserer Erfahrung nach haben sich erfolgreiche Formate wie Teamvorstellungen in Form kurzer Interviews bewährt. Sie geben Einblicke in den Alltag, vermitteln Wertschätzung und machen die Menschen hinter der Institution sichtbar – authentisch und auf Augenhöhe.
3. Strategie: Social Media First
Eine zeitgemäße Kommunikationsstrategie setzt zuerst auf den Aufbau einer authentischen Community in sozialen Medien. Der Schlüssel: Nicht Marketing-Sprech, sondern echte Geschichten von echten Menschen. Social Media ist ein Mittel, um Menschen zu erreichen, sie für die eigene Arbeit zu begeistern und mit ihnen in Dialog zu treten. Dafür braucht es Inhalte, die berühren, informieren und zum Nachdenken anregen – keine oberflächlichen Werbebotschaften.
Langfristig denken statt kurzfristiger Effekte
Der Weg zu einem besseren Image ist ein Marathon, kein Sprint. Es geht nicht darum, einmalige Kampagnen zu starten, sondern eine langfristige, authentische Kommunikationskultur zu etablieren. Das Überstülpen von Projekten kann nicht funktionieren. Ebenso wenig hilft es, sich nur auf den Beschäftigtenzuwachs zu konzentrieren oder eine vermeintliche Inklusivität vorzugeben, die im Alltag nicht gelebt wird. Auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist eine authentische Kommunikation unverzichtbar: Nicht jede Werkstatt kann sich auf Großkunden verlassen, die über Jahre aufgebaut wurden – und selbst diese Kundenbeziehungen werden immer fragiler. Langfristig werden sich Werkstätten ohne Imagearbeit kaum behaupten können – weder bei der Gewinnung neuer Beschäftigter noch bei der Akquise von Aufträgen in einem zunehmend kritischen Marktumfeld.
Stattdessen müssen Werkstätten den Mut aufbringen, offen über Herausforderungen zu sprechen und echte Partizipation zu ermöglichen. Das bedeutet, die klassische Expertenhaltung zu hinterfragen und Menschen mit Beeinträchtigung nicht nur mitzunehmen, sondern sie mitentscheiden zu lassen.
Fazit: Den Mut zur Authentizität finden
Werkstätten können ihr Image beeinflussen – aber nur, wenn sie den Mut zur Authentizität finden. Sie müssen akzeptieren, dass es nicht um ein perfektes Bild geht, sondern um ehrliche Reflexion. Eine inklusive, wertebasierte Kommunikation, die Beschäftigte in den Mittelpunkt stellt, ist der Schlüssel. Dieser Weg lohnt sich – nicht nur für das Image nach außen, sondern auch für die Kultur im Inneren. Werkstätten, die ihre Beschäftigten aktiv einbeziehen, schaffen Selbstwirksamkeitserfahrungen und fördern die Identifikation mit dem Unternehmen. Sie zeigen: Hier zählt jede Stimme, hier wird echte Teilhabe gelebt.
Kontakt
Die Autorinnen dieses Beitrags arbeiten bei catavi UG, einem Beratungsteam, das soziale Unternehmen unterstützt, ihre Werte klar zu kommunizieren und echte Teilhabe zu ermöglichen. Mehr unter www.catavi.de
Zurück zur Artikelübersicht