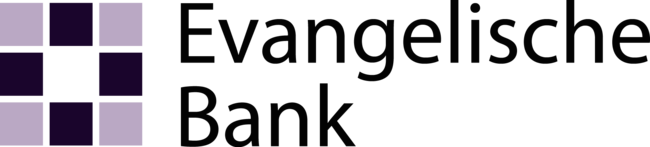Zwischen Sicherheit und Wandel
Ein Plädoyer für mehr Risikobereitschaft

Ein Beamter kommt nach 29 Dienstjahren zu seinem Chef und sucht eine neue Aufgabe. Chef: "Lehmann, Sie sitzen jetzt seit 29 Jahren im gleichen Büro und wollen sich nun versetzen lassen?" Lehmann: "Tja Chef, das ist halt das wilde Abenteurerblut in mir!"
Seien wir mal ehrlich: Hat sie nicht ihren besonderen Reiz in Zeiten der politischen Krisen, der Massenentlassungen, des drohenden oder tatsächlichen Wohlverstandsverlusts immer breiterer Gesellschaftsgruppen? Die Unkündbarkeit des Arbeitsverhältnisses. Die Planbarkeit von Tages-, Wochen- und Jahresabläufen. Die Berechenbarkeit der Anforderungen zu Hause und im Beruf. Kurz: die Sicherheit.
Besonders schwache Menschen brauchen Sicherheit. So das Paradigma der Sozialgesetze. Und hier wiederum sind es Menschen mit Behinderung, die den höchsten Schutz in unserer Gesellschaft genießen. Einen Rechtsanspruch auf Arbeit? Den gibt es nur hier. Ein ausdifferenziertes System der Bereitstellung von Wohnraum, von Unterstützung, von Ermöglichung der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft - für keine andere Personengruppe existiert ein derart umfassendes Hilfesystem. Und das ist gut so.
Nun stehen wir vor besonderen Herausforderungen. Das Finanzsystem ist durch riesige Kreditaufnahmen des Staates ungeheuren Belastungen ausgesetzt. Die Wirtschaft läuft schlecht, die öffentlichen Haushalte verschulden sich weiter. Gleichzeitig wuchs die Zahl der Menschen mit besonderem Hilfebedarf. In den letzten 10 Jahren stiegen die Ausgaben der Eingliederungshilfe um über 60 %, die der Sozialhilfe alleine im letzten Jahr um 18 %. Die Ausbreitung psychischer Erkrankungen hält unvermindert an und die Gesellschaft altert. In den 60er Jahren kamen auf einen Rentenbezieher sechs Erwerbstätige, heute nicht mal zwei.
Das hat zur Folge, dass mehr Menschen um weniger Mittel konkurrieren. In unserer wettbewerbsorientierten Gesellschaft bedeutet das ein ‘Jeder gegen Jeden’. Gegner sind nicht die immer reicher werdenden Vermögenden, sondern die Gruppe der Bedürftigen ‘unter’ oder neben der eigenen. Auf jeden Fall gilt es erst einmal, das Erreichte, die Besitztümer zu verteidigen – frei nach der Devise: ein festes Haus ist unsere Burg.
Übertragen auf uns, unsere Arbeit bedeutet dies: ein festes Haus ist unsere Einrichtung, unser Angebot, unser Dienst, unsere Firma. Nicht dass wir dies um unser selbst Willen so verständen. Es ist die Leistung für den behinderten Menschen, seine Förderung und Unterstützung, seine Sicherheit, die es zu wahren gilt.
Vieles, was neu daherkommt, könnte dies gefährden. In den berechtigten Kampf gegen die Verschlechterung von Sozialleistungen vermischt sich da schnell die Skepsis gegenüber neuen Paradigmen, Strukturen und Verfahren der Hilfeerbringung. Auf dem Papier hört sich alles gut an: Personenzentrierung, Inklusion, Individualisierung und Flexibilisierung. Aber wenn es um die praktische Umsetzung geht, dann sind die Bedenken groß: "Letztlich will der Staat nur sparen" und "dem behinderten Menschen drohen Leistungskürzungen und Einsamkeit" – so die gängigen Einschätzungen.
Szenenwechsel: Wenn wir auf unser Leben zurückschauen, auf die Momente und Umstände, in denen wir uns weiterentwickelten, in denen wir Klarheit und Kreativität erlangen konnten – dann waren es nicht unbedingt die klar strukturierten und geregelten Lebensabschnitte, sondern vielmehr auch die Brüche, die Abschiede und Neubeginne, die Verluste und unerwarteten Gewinne, an denen wir gewachsen sind und unsere Persönlichkeit entfalten konnten. Gilt dieses nicht auch für die Menschen, die chronisch erkrankt, die behindert sind und die vielleicht lebenslang versorgt und unterstützt werden (müssen)? Beinhaltet das Festhalten an einer bestimmten Leistungsform vielleicht nicht auch eine Verringerung von Chancen? Wirkt die Verringerung von Risiko wirklich immer stabilisierend? Wie viel Unsicherheit braucht der Mensch zu seiner Entfaltung?
In einer Dichte wie selten zuvor sind in den vergangenen Jahren auf verschiedensten Ebenen Überlegungen zu einer Änderung der Hilfen für Menschen mit Behinderung angestellt worden. Die UN-KONVENTION formuliert "das gleichberechtigte Recht aller behinderten Menschen, mit gleichen Wahlmöglichkeiten wie die anderen Menschen in der Gemeinschaft zu leben." Der DEUTSCHE VEREIN will "die bisher institutionsgebundenen Leistungen der Eingliederungshilfe und der Agentur für Arbeit als personenzentrierte Leistungen ausgestalten". Die Selbstvertretungsorganisationen der Behinderten fordern echte Partizipation.
Entfaltung braucht manchmal die Chance zum Risiko. Das gilt für Menschen wie für Einrichtungen. Ich meine: Wir könnten es riskieren, in der Behindertenhilfe ein wenig mutiger zu sein.
Anton Senner
Vorstandssprecher Bergedorfer Impuls Stiftung, Hamburg
Zurück zur Artikelübersicht