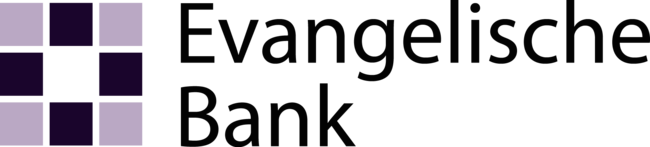Ausgangsverfahren WfbM: Es geht um mehr als Abschied
Bericht zur Fachtagung „Der schwierige Übergang von der Werkstatt in den Ruhestand“

Der Übergang in den Ruhestand ist ein bedeutsamer Einschnitt im Leben, auch für Beschäftigte in Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM). Er sollte nicht als Bruch oder Ausschluss erlebt werden, sondern als Beginn eines neuen, erfüllten Lebensabschnitts. Werkstätten, die den Übergang aktiv gestalten, erhöhen die Chance auf Teilhabe, Gemeinschaft und Selbstbestimmung im Alter.
Die Fachtagung „Der schwierige Übergang von der Werkstatt in den Ruhestand“ am 23. und 24. Juni 2025 in Kassel bot praxisnahe Impulse und Raum zur Entwicklung eigener Ideen. Am ersten Tag wurden vier gelungene Praxisbeispiele aus unterschiedlichen Werkstätten vorgestellt. Der zweite Tag diente der Konzeption von Projekten durch die Teilnehmenden.
Der Aktiv-Club
Anna-Maria Klumpp, Sozialdienst und Abteilungsleitung in den UlrichswerkstättenSchwabmünchen, stellte zu Beginn den „Aktiv-Club“ vor, ein flexibles, offenes Angebot für älter werdende Beschäftigte. Der Ausgangspunkt war ein partizipativer Zukunftsworkshop mit Werkstattbeschäftigten, Personal und Angehörigen. Eines der Ergebnisse war der Plan für einen Übergangsbereich zur Berentung.
Im Aktiv-Club bieten drei Mitarbeiter*innen bedarfsgerechte Aktivitäten an: Biografiearbeit, Musik, Kreativangebote, Ausflüge, Gedächtnistraining, Bewegung, Hauswirtschaft, Gespräche zur Rentenzeit sowie leichte Arbeiten, z. B. in einer Fahrradwerkstatt. Die Räumlichkeiten umfassen Aufenthaltsräume mit Küchenzeile und Ruhebereichen, einen Arbeitsraum und Sanitäreinrichtungen
Der Aktiv-Club kann in Teilzeit, also stunden- oder tageweise, oder auch in Vollzeit genutzt werden. Teilnehmen dürfen Beschäftigte ab 50 Jahren oder Jüngere mit besonderem Bedarf. Die Finanzierung erfolgt ohne zusätzliche Mittel: Bei mehr als 50 % Anwesenheit fließt der Kostensatz an den Aktiv-Club, sonst verbleibt er bei der Arbeitsgruppe. Die Teilnehmenden erhalten mindestens den Grundlohn mit niedriger Leistungsstufe, Förderstätten-Teilnehmende keinen Lohn.
In Schwabmünchen ist der Aktiv-Club eng in den Werkstattalltag eingebunden und kein Ausgrenzungsmodell. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Thema Demenz, insbesondere bei Menschen mit Trisomie 21. Das Personal wird geschult und stellt spezielle Angebote bereit.

Anna-Maria Klumpp stellt den AktivClub vor

Altern als Aufgabe für die ganze Werkstatt
Die Caritas Wohn- und Werkstätten Niederrhein (CWWN) stellt ihr Konzept unter den Leitgedanken: „Kein Abschieben im Alter“. Sozialdienstleiterin Yvonne Evers betont: „Der Umgang mit dem Thema Altern ist eine gemeinsame Aufgabe der gesamten Werkstatt.“
Die Beschäftigten sollen möglichst lange in ihrer Gruppe verbleiben können. Dafür wurden bauliche Veränderungen umgesetzt: ergonomische Arbeitsplätze, Ruhezonen, Türöffner, Schallschutz, visuelle und akustische Orientierungshilfen. Regelmäßige Schulungen sensibilisieren das Personal. In jeder Betriebsstätte kümmern sich je eine Person aus dem Sozialdienst und den Gruppenleitungengemeinsam um das Thema Alter. Eine enge Zusammenarbeit mit Wohnbereich, Angehörigen und Betreutem Wohnen ist zentral. Auch individuelle Teilzeitmodelle sind möglich. Der „Seniorenstatus“ wird im Rahmen der jährlichen Teilhabeplanung zwei Jahre vor Renteneintritt oder bei vorzeitigem Alterungsprozess festgelegt.
Zukünftige Rentner:innen treffen sich monatlich, um Themen wie Rentenansprüche, Freizeit oder soziale Kontakte zu besprechen. Auch nach Renteneintritt bleiben können sie mit der Werkstatt in Kontakt bleiben, durch Besuche oder ehrenamtliches Engagement.
Übergang im Qualitätsmanagement verankert
Die Hagsfelder Werkstätten Karlsruhe (HWK) setzen ebenfalls auf ein inklusives Übergangsmodell. Geschäftsleitung Rehabilitation und Bildung Simon Scholtz und Betriebsstättenleiter Frank Klittich präsentierten ihr Konzept, das das Thema „Älterwerden“ fest im Unternehmens- und Qualitätsmanagement verankert. Ab dem 55. Lebensjahr wird in Beratungsgesprächen gezielt über Alter und die besonderen Bedürfnisse gesprochen, ab 63 ist eine jährliche Beratung Pflicht. In die Teilhabeplanung bzw. deren Umsetzung sind Sozialdienst, Fachkräfte, Wohnbereich, Angehörige und Betreuende eingebunden. Den Fachkräften stehen ein Leitfaden und eine hilfreiche Materialiensammlung zur Verfügung.
Beim Verzicht auf altersbedingte Sonderstrukturen setzen die Karlsruher auf ergänzende Angebote, die den Arbeitsprozess unterstützen. Pflegedienst- und Alltagsassistenzkräfte bieten in speziellen Räumen stundenweise Rückzugsmöglichkeiten mit altersbegleitenden Angeboten (ABA), z. B. Backen, Kochen oder Spielen. Menschen mit psychischer Erkrankung können die Gruppe „60+“ besuchen, die selbstgewählte Themenbearbeitet.
Ein „Steuerungskreis Senioren“, bestehend aus Geschäftsleitung sowie Leitungskräften aus dem Förder- und Betreuungs- und dem Wohnbereich, entwickelt die Angebote kontinuierlich weiter. Für Teilzeitlösungen werden beim Leistungsträger zusätzliche Mittel zur „Teilhabe am sozialen Leben“ im Wohnbereich beantragt.

Die Hagsfelder Werkstätten in Karlsruhe stellen ihr Konzept vor.
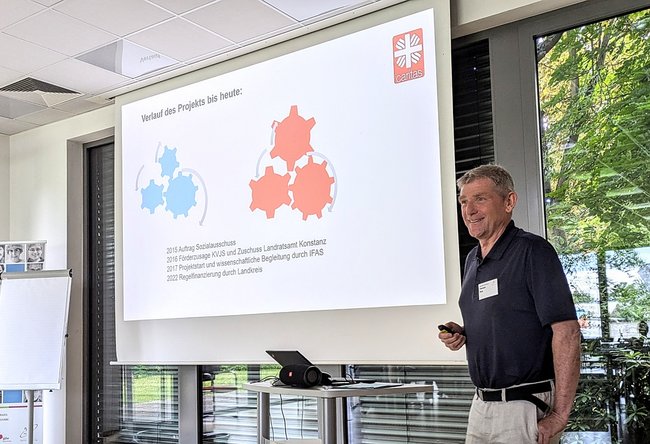
Die Individuellen Ruhestandslotsen der Caritasverbände
Individuelle Ruhestandslotsen
Einen komplementären Ansatz verfolgen die „Individuellen Ruhestandslotsen“, ein Projekt der Caritasverbände Konstanz und Singen Hegau in Kooperation mit dem Landkreis Konstanz. Zuständig sind Markus Spranger (Singen) und Thomas Rick (Konstanz), der das Konzept vorstellte. 2017 gestartet, wird es seit 2022 durch den Landkreis regulär finanziert.
Die Idee: Menschen mit Behinderung nicht nur auf den Ruhestand vorzubereiten, sondern auch darüber hinaus zu begleiten, etwas bei der Pflege sozialer Kontakte und der Suche nach Wohnmöglichkeiten, besonders wenn keine anderweitige Betreuung vorhanden ist.
In Singen wurde mit der Werkstatt ein Konzept analog zum Eingangsverfahren im BBB etabliert: das „Ausgangsverfahren“. Beschäftigte werden gemeinsam auf den Ruhestand vorbereitet und durch den Ruhestandslotsen über den Renteneintritt hinaus begleitet.
Zu den Angeboten gehören Kurse „55+“, monatliche Sprechstunden, ein Stammtisch, die Nutzung von Sozialraum-Angeboten, der Aufbau von Begegnungsstätten, Familien- und Einzelberatung. Ehrenamtliche bilden Tandems mit den begleiteten Personen. Thomas Rick: „Die Nachfrage steigt deutlich, doch die Gewinnung von Ehrenamtlichen bleibt eine Herausforderung.“
Der zweite Tag: Ideen für die eigene Praxis
Nach dem ersten Tag mit Fachinput und Praxisbeispielen stand der zweite Tag ganz im Zeichen der Entwicklung eigener Konzepte. Den Auftakt bildete ein World Café, in dem zentrale Fragen diskutiert wurden: Wer muss beteiligt werden? Welche Inhalte sollen wir bieten? Wie organisieren wir die Umsetzung? Welche personellen und materiellen Ressourcen sind nötig?
Diese thematische Vertiefung bildete die Grundlage für eine Phase der Entwicklung eigener Ideen. Im anschließenden Plenum stellten die Teilnehmenden ihre Ansätze vor und suchten gezielt Mitstreiter für ähnliche Vorhaben. Es bildeten sich fünf Arbeitsgruppen, die erste Projektskizzen entwickelten.
Anschließend wurden diese Planungen im Format der „Wertschätzenden Konfrontation“ reflektiert. Dabei präsentierte jeweils ein Gruppenmitglied das Vorhaben. Teilnehmende aus anderen Gruppen bewerteten es in der Rolle des „Euphorikers“, „Kritikers“ und „Pragmatikers“. Ziel war es, unterschiedliche Perspektiven zu sammeln, Stärken und Schwächen der Planung zu benennen und siezu einer realistischen Gesamtsicht zusammenzuführen.
Mit diesen Impulsen überarbeiteten die Gruppen ihre Vorhaben und präsentierten sie abschließend erneut im Plenum. Für die Fortführung ihrer Projekte in der eigenen WfbM benannten erste konkrete Schritte und sondierten Möglichkeiten zur Kooperation mit ihren Gruppenmitgliedern.
Die Ergebnisse reichten von der ersten Kontaktaufnahme bis hin zu umfassenden Konzepten auf Einrichtungsniveau. Die Planungen beinhalteten
• den Aufbau von Allianzen innerhalb der Einrichtung,
• die Vernetzung im Sozialraum zur Nutzung bestehender Angebote,
• die Planung langfristiger Bildungsangebote für Älterwerdende,
• die Entwicklung eines „Ausgangsverfahrens“ zur Begleitung in den Ruhestand,
• die Erstellung eines Gesamtkonzepts für die gesamte Werkstatt.

Das Projekt Ausgangsverfahren WfbM

Aktiv Teilnehmende der Fachtagung
Fazit
Die Rückmeldungen der Teilnehmenden zu dieser Fachtagung fielen durchweg positiv aus:
„Kreativ und lebendig hat Spaß gemacht.“
„Gute Verbindung von Theorie und Praxis.“
„Die Dozent:innen kamen aus der Praxis und haben die Inhalte überzeugend vermittelt.“
„Man merkte: Den Veranstaltern war wichtig, dass jede:r etwas Konkretes mitnehmen konnte.“
In der Abschlussrunde herrschte Einigkeit: Der Übergang in den Ruhestand ist keine Kür, sondern eine Pflichtaufgabe jeder Werkstatt. „Das Thema ist kein Nice-to-have, sondern ein Must.“
Zurück zur Artikelübersicht