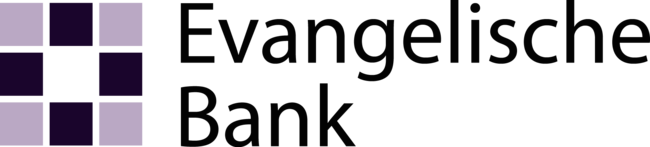Israelische Erfahrungen als Wegweiser
Berufliche Teilhabe in Altenheimen und Kindergärten

Ende Oktober 2025 versammelten sich Leitungen, Fachkräfte und Soziale Dienste aus Werkstätten zu einer Fachtagung von 53° NORD in Kassel. Unter dem Titel „Berufswunsch Arbeit mit Kindern und Senioren – Chancen, Tätigkeiten und Qualifizierungsgänge“ standen berufliche Perspektiven für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung in Alteneinrichtungen und Kindergärten im Mittelpunkt.
Die Ursprünge lagen in Israel
Die Wurzeln des Einsatzes von Werkstattbeschäftigten in Sozialeinrichtungen reichen drei Jahrzehnte zurück. 1995 reiste Marin Müller-Erichsen, Vorsitzende der Lebenshilfe Gießen, mit einer kleinen Delegation nach Israel, um dort zu erkunden, wie Menschen mit „geistiger Behinderung“ erfolgreich in der Altenpflege arbeiten. Die Erkenntnis: Die bei diesem Personenkreis häufig anzutreffenden Eigenschaften wie Geduld, Fürsorglichkeit, Freundlichkeit und eine positive Ausstrahlung werden in der Altenpflege dringend benötigt. Die Israelischen Erfahrungen lassen sich auch auf Deutschland übertragen. Besonders beeindruckend war, dass die Beschäftigten nicht mehr als Hilfeempfänger, sondern als Helfer agierten. Verantwortung zu übernehmen, zu unterstützen und Teil eines Teams sein zu können, veränderte ihre Selbstwahrnehmung nachhaltig.
Zurück in Deutschland entstand das Modellprojekt „Helfer in der Altenpflege“, eine Kooperation zwischen der Lebenshilfe Gießen und den Elbe-Werkstätten Hamburg, gefördert aus Mitteln der Ausgleichsabgabe. Das Projekt kombinierte die praktische Tätigkeit in Senioreneinrichtungen mit einer berufsbegleitenden Qualifizierung. Der Erfolg bildete die Grundlage für die ersten ausgelagerten Berufsbildungsplätze, die inzwischen auch gesetzlich verankert sind. Tätigkeiten in Seniorenheimen und in der Folge auch in Kindergärten gehören heute zu den wichtigsten Berufsfeldern für betriebsintegrierte Werkstattplätze, und viele Beschäftigte konnten in sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse übernommen werden.
Erfahrungsberichte aus der Praxis
Der erste Tag der Tagung stand im Zeichen von Erfahrungsberichten. Sven Neumann von den Elbe-Werkstätten in Hamburg berichtete über den Fortgang des Altenpflegeprojekts und über das anschließende Projekt in Kindertagesstätten, das gemeinsam mit der Fachschule für Sozialpädagogik entwickelt wurde und ebenfalls bis heute erfolgreich ist.
Michael Schumann und Janett Steffens-Grüning von der Lebenshilfe Braunschweig stellten ihre eigenen langjährigen Erfahrungen vor. Auch dort wurden schon früh Arbeitsplätze in Kindergärten und Altenheimen angeboten, begleitet von bedarfsgerecht entwickelten Qualifizierungen.
Doreen Dietmann vom Fachdienst Integra Mensch der Lebenshilfe Bamberg erläuterte ihre berufsbegleitenden Zertifikatslehrgänge. Sie sind EDV-gestützt, individuell anpassbar und in einem bundesweiten Netzwerk etabliert. Die Lehrgänge decken mittlerweile nicht nur Tätigkeiten in Altenpflege oder Kindergärten ab, sondern 14 unterschiedliche Qualifizierungsfelder.
Die Botschaft der Referentinnen und Referenten war klar: Altenpflegeeinrichtungen und Kindergärten sind offen für integrative Tätigkeiten von Menschen mit Behinderung. Ist der Grundstein erst gelegt, übersteigt oft die Nachfrage das Angebot. Entscheidend für den Erfolg sind verlässliche Begleitung, kontinuierliche Kommunikation mit den Betrieben und die Kombination aus Praxisanteilen und theoretischer Qualifizierung.
Herausforderungen und Lösungsansätze
Klar wurde auch: Die Übernahme von pädagogischen oder pflegerischen Tätigkeiten bildet eher die Ausnahme. Meist liegen den Aufgaben im hauswirtschaftlichen oder begleitenden Bereich, immer sind sie aber eine Ergänzung und Entlastung der Fachkräfte. Persönlichkeitsentwicklung und Reifung spielen bei der Integration eine große Rolle. Scheitert ein Versuch mit 18, kann er mit 28 Jahren erfolgreich sein. Finanzierungsfragen stellen eine weitere Hürde dar, sind aber nicht unüberwindlich. Private Träger tun sich oft leichter als kirchliche oder öffentliche Einrichtungen.
Haben Werkstattbeschäftigte erst einmal Fuß gefasst, wachsen sie oft über die ihnen zugewiesene Rolle von „Hilfskräften mit Behinderung“ hinaus und werden zu voll integrierten und geschätzten Teammitgliedern. Die Beeinträchtigung gerät zunehmend in den Hintergrund, sowohl für Kolleginnen und Kollegen, als auch für Kinder, Eltern oder Bewohnerinnen und Bewohner.
Bei den Qualifizierungsgängen hat sich das Bamberger Modell besonders bewährt. Die Zertifikatslehrgänge sind gut ausgearbeitet und mittlerweile über ein großes Netzwerk verbreitet, was die Anerkennung durch die autonomen Kammern und andere Zertifizierungsstellen erleichtert.
Perspektivwechsel und gemeinsame Erarbeitung
Der erste Tag der Tagung war überwiegend den Informationen vorbehalten, der zweite Tag diente den Austausch und der Planung. In einer Abwandlung des „World Cafés“ setzten sich die Teilnehmenden intensiv mit den Perspektiven aller Beteiligten auseinander: Menschen mit Behinderung, Werkstätten, Jobcoaches und Praxisbetriebe. Besonders eindrücklich war ein Rollenspiel, bei dem die Teilnehmenden in die Rolle von Werkstattbeschäftigten schlüpften und aus deren Sicht Erwartungen, Hoffnungen und Ängste bezüglich einer Tätigkeit in Altenheimen oder Kindergärten artikulierten.
Die Tagung endete in konkreten Plänen zum Transfer der gewonnenen Erkenntnisse in den Arbeitsalltag der TeilnehmerInnen. Diese reichten von der Weitergabe der Informationen an den Kreis der KollegInnen bis zur Neukonzeption ganzer Aufgabenfelder einschließlich der Entwicklung neuer Qualifizierungsgänge.

Fazit: Impulse für die Praxis
Die Rückmeldungen zur Fachtagung waren durchweg positiv. Die Kombination aus praxisnahen Erfahrungsberichten, intensiven Diskussionen und interaktiven Elementen wurde geschätzt, ebenso die Möglichkeit, den Transfer der Erkenntnisse zu planen und die Ideen mit der kritischen Rückmeldung anderer TeilnehmerInnen abzugleichen. Das Resümee: Die Tagung lieferte wertvolle Impulse, um in der eigenen Werkstatt die Integration von Menschen mit geistiger Behinderung in Altenpflege und Kindertagesstätten weiter zu stärken.
Die Vision von Maren Müller-Erichsen aus dem Jahr 1995 – Werkstätten zu öffnen und Teilhabechancen zu erweitern – hat mit dieser Tagung weiteren Schwung aufgenommen. Menschen mit geistiger Behinderung können verlässliche und geschätzte Mitarbeitende sein, wenn Begleitung, Qualifizierung und Praxisintegration zusammenwirken. Die Tagung hat gezeigt, dass dies nicht nur den Beschäftigten, sondern auch Werkstätten, Betrieben und der Gesellschaft als Ganzes zugutekommt.